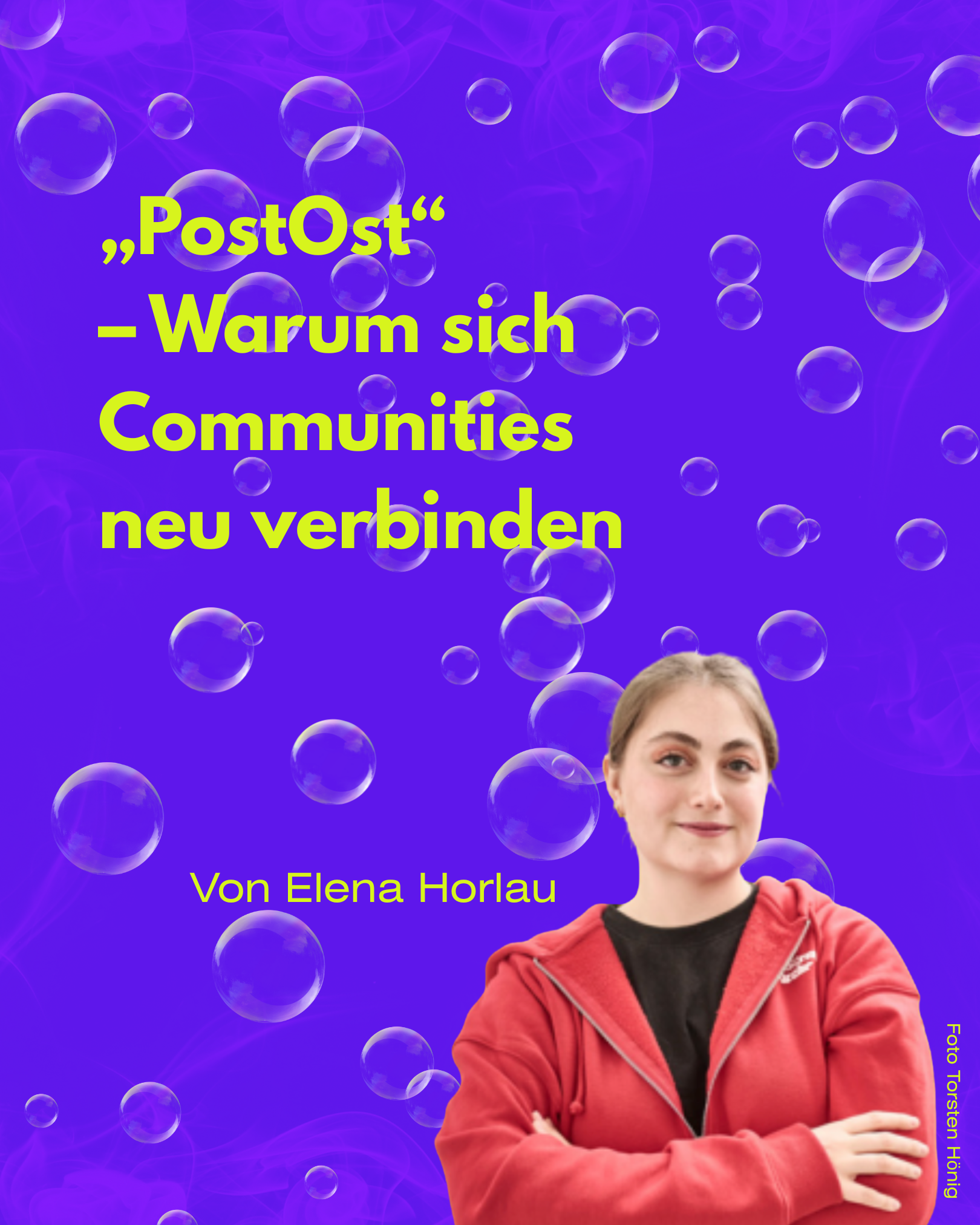Seit 2024 bin ich Teil des Nürnberger künstlerischen Kollektivs Semetchki – eine Gruppe junger jüdischer Kontingentflüchtlinge und Russlanddeutscher. Unsere Initiative ist jedoch nicht die erste: In ganz Deutschland entstehen diverse Projekte unter dem Label PostOst, die Menschen mit Bezug zum postsowjetischen Raum zusammenbringen und neue Diskursräume eröffnen.
Es besteht seit Jahrzehnten eine starke, von den Migranten selbst geschaffene Infrastruktur (Supermärkte, Bildungsangebote etc.). Und doch zeigt eine Studie von Ben Rafael aus dem Jahr 2008, dass, zumindest aufseiten der Kontingentflüchtlinge, kaum ein Zugehörigkeitsgefühl mit allen Russischsprachigen in Deutschland herrschte. Die Verbindung zur jüdischen Gemeinde war deutlich stärker ausgeprägt. In den 80er-/90er-Jahren kämpften Russlanddeutsche mit großen Integrationsbarrieren. Als wenig später jüdische Kontingentflüchtlinge kamen, hatten sich die Strukturen bereits verbessert – und sie fanden Anschluss in den jüdischen Gemeinden. Das schuf aber auch Distanz zu anderen Russischsprachigen.
Was hat den aktuellen Wandel ausgelöst?
1. Junge Generation fragt nach ihren Wurzeln
Während Eltern mit Integration und Behörden beschäftigt waren, hinterfragen junge Menschen heute Familiengeschichten und entdecken Parallelen und Unterschiede. Die künstlerische Arbeit von Semetchki macht Migrationserfahrungen und das Aufwachsen zwischen den Kulturen sichtbar.
2. Sprache schafft Bewusstsein
Begriffe werden kritisch betrachtet und zunehmend durch die Community ersetzt (z.B. Migrationsgeschichte statt „Hintergrund“). Gleichzeitig wird PostOst zum Sammelbegriff für eine Generation, die sich nicht mehr durch die ehemalige Sowjetunion exklusiv „russisch“,, „deutsch“, oder „jüdisch“, definieren will und Platz für mehrfache Zugehörigkeiten abseits der Fremdzuschreibungen schafft.
3. Der Ukraine-Krieg als Katalysator
Viele junge Menschen mit Bezug zur ehemaligen Sowjetunion engagieren sich stark in der Ukraine-Hilfe. Durch Übersetzen, Behördenbegleitung oder Kulturprojekte entstehen neue Solidaritäten, die über religiöse oder ethnische Grenzen hinweggehen und eher auf sprachlicher und biografischer Nähe basieren.
Die vielen Initiativen zeigen: Die Realitäten vieler Russlanddeutscher und jüdischer Kontingentflüchtlinge werden im neuen Licht betrachtet und selbstständig neu artikuliert. Es geht nicht mehr nur um Integration und klare Einordnung, sondern um Sichtbarkeit und Fluidität.
von Elena Horlau, Kunstpädagogikstudentin
Dieser Text erschien zuerst in der EDA III (September 2025).